
Roman über eine Arbeiterfamilie in der Zeit von 1910 bis 1980, die Anfang letzten Jahrhunderts aus dem Westerwald nach Köln in die dortige neue Humboldt-Siedlung in Deutz zog. Ein eindrucksvolles Genrebild aus vergangener Zeit.
ISBN 978-3-939973-11-9
erschienen am 15. September 2010 im alcorde Verlag 19,80 €
www.alcorde-verlag.de
erhältlich in allen Buchhandlungen , bei den Internetanbietern oder direkt beim Verlag:
Hier der Anfang des Romans "Thea":
2007
Gedankenverloren saß die alte Dame in ihrem Ledersessel, in dem sie nahezu den ganzen Tag verbracht und ihre Gäste empfangen hatte. Schön war dieser Tag gewesen, richtig schön, aber auch anstrengend. Das musste wohl so sein, wenn man immer älter wurde, jede und jeden überlebt und mehr Erinnerungen hatte als alle diejenigen zusammen, die sie besuchen kamen.
Achtundachtzig Jahre war sie heute geworden, kaum glauben konnte sie es. Achtundachtzig, das war eine lange Zeit, in der vieles geschehen war, sich verändert hatte, Menschen vorübergezogen waren. Und gegangen waren sie, die Menschen, die ihren Weg begleitet hatten, gegangen für immer. Nur sie, sie lebte noch, nahm Anteil an den Geschichten der Jüngeren, lachte mit ihnen und lebte doch in einer ganz anderen Welt, einer Welt, die diese nicht kannten und nie kennen würden. Manchmal sagten sie: „Erzähl mal, Tante Thea!“, aber dann sah sie doch, wenn sie erzählte, dass die Gedanken der anderen abschweiften, dass die Gegenwart sie gefangen nahm und ihre Kräfte absorbierte. Dann schwieg sie, nie vorwurfsvoll, wusste sie doch, dass die Erinnerungen nur ihr gehörten, nur ihr wichtig waren, ihr Kraft gaben für die Zeit, die noch vor ihr lag.
Sie seufzte ein wenig und erhob sich mühsam, wobei sie sich auf der Sessellehne abstützte, denn das Aufstehen fiel ihr schwer. Neben ihr lehnte der Stock, ohne den sie schon lange nicht mehr gehen konnte. Die Sicherheit, die er ihr gab, wollte sie nicht mehr entbehren. Auf ihn gestützt ging sie die wenigen Schritte bis in ihre Küche, um sich ein Glas Tee zu holen. Dort sah sie sich um. Alles war aufgeräumt, nichts mehr erinnerte an das Durcheinander des Tages, das bereits um 11 Uhr mit dem Besuch des Pfarrers begonnen und um 18 Uhr mit dem Abschied ihrer Tochter geendet hatte. Alles Geschirr war gespült worden, denn zu einer Spülmaschine hatte sie sich bisher nicht durchringen können – „es wird sauberer, wenn man mit der Hand spült“, daran glaubte sie fest, und dann musste man sich auch nicht mehr umgewöhnen. Der Rest des Kuchens war im Kühlschrank verstaut, wie sie feststellte, als sie hineinschaute, und der Fußboden war geputzt. Ihre Tochter war ein Goldstück. Sie ließ sie nicht im Stich, auch wenn sie ihr eigenes Leben führte. Das musste ja auch so sein, die Jungen müssen ihren Weg gehen, ja, das müssen sie, auch wenn es manchmal schwer und der Weg unverständlich war.
Kurz durchzuckte sie der Gedanke, dass es mit ihrer Tochter nicht immer so gewesen war, so harmonisch und mühelos wie heute, so herzlich, ganz so wie zwischen Mutter und Kind, die einander fast Freundinnen sind. Freundinnen – wann war das, als sie geglaubt hatte, die Tochter hasse sie? Bitter waren alle diese Jahre gewesen, eine so lange Zeit … Ach nein, daran wollte sie heute nicht denken! Vorbei! Nur das Schöne sollte wiederkehren, nur dieses, und sie deckte das Unbehagen, das in ihr aufgestiegen war, durch Normalität zu: Dort lag ein kleiner Papierschnipsel auf dem Boden, unbemerkt heruntergefallen, zu dem bückte sie sich schwerfällig, den Stock zu Hilfe nehmend. Es wäre ihr nie eingefallen, ihn dort liegen zu lassen, bis ihre Haushaltshilfe morgen früh kam. Sie hatte es sich abringen müssen, dass diese Hilfe kam. Bis vor wenigen Jahren hatte sie alles noch allein gemacht, aber das war ihr dann doch sehr mühselig geworden, und nun war sie auch froh darüber, dass sie ein Stück Verantwortung hatte abgeben können.
Endlich hatte sie es geschafft, das Papier von dem Linoleumboden aufzuheben und in den Mülleimer zu werfen. Das Linoleum hatte ihre Tochter schon lange ersetzen wollen durch etwas Moderneres, Laminat vielleicht oder einen dieser pflegeleichten Kunststoffböden. Aber dagegen hatte sie sich dann doch heftig gewehrt. Den Küchenboden hatte ihr Mann gelegt, vor vielen
Jahren, ihnen beiden hatte das Stahlblau so gut zu der hellen Einbauküche gefallen. Und das Linoleum würde sie überleben, da war sie ganz sicher.
...
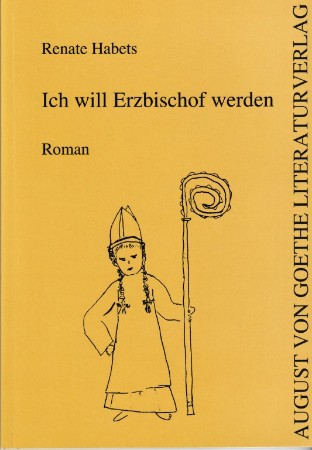
Der Roman erzählt die Geschichte eines unehelich geborenen Mädchens, das nach dem Kriegsende in einer katholisch geprägten Umwelt aufwächst und sehr bald deren Vorbehalte schmerzlich erfährt, was durch den Besuch einer Klosterschule verstärkt wird. Die sich daraus entwickelnden Schuldgefühle versucht es durch Leistung zu kompensieren. Vorbild auf diesem Weg voller Demütigungen und Selbstverleugnung ist die Mutter, die ihren "Fehltritt" durch übertriebenen Ehrgeiz zu kompensieren versucht.
Spannend, atmosphärisch sehr dicht, Betroffenheit auslösend, aber auch humorvoll wird diese Geschichte erzählt.
ISBN 978-3-8372-0000-3
€ 9,90
Das Buch kann in jeder Buchhandlung bestellt, aber auch im Internet bezogen werden.
Der Anfang des Romans "Ich will Erzbischof werden":
1. Kapitel
Das Baby
Eigentlich sollte es im Krankenhaus der Kreisstadt geboren werden. Frühzeitig hatte sich die Mutter, als sie die Wehen spürte, auf den Weg gemacht. Da es Krieg war, musste sie ihn zu Fuß bewältigen und so war sie rechtzeitig aufgebrochen, nur begleitet von einem alten Onkel, der ihren Koffer hielt und dafür Sorge tragen sollte, dass sie das Krankenhaus erreichte.
Hier, in diesem entlegenen Winkel, war der Krieg weit entfernt und man fand genügend zu essen und fühlte sich sicher. Das war der Grund, warum die Mutter mit ihrer Mutter in deren elterliches Haus gegangen war, die geliebte Großstadt verlassen hatte, um hier in vermeintlicher Ruhe die Geburt ihres ersten Kindes und den Krieg abzuwarten.
Hier kannten sie alle, hier wussten alle, was ihr widerfahren war, dass sie dieses Kind trug ohne einen Ehemann, ohne den Ring am Finger, der ihr die Sünde genommen hätte.
Nun war die Zeit gekommen, sich auf den Weg zu machen und dieses Kind zu gebären. Bisher hatte sie sich hier sicher gefühlt vor dem Krieg, gemeinsam mit all den alten Verwandten, die das Haus füllten und ihr – so glaubte sie – auf den wachsenden Bauch starrten. Dennoch - vor dem Krieg hatte sie sich sicher gefühlt!
Die Mutter und der Onkel waren noch nicht weit gekommen auf ihrem Weg über den Berg, als sie plötzlich ein Sausen, dann ein Heulen hörten, das sich näherte.
„In den Graben“, konnte der alte Onkel noch schreien, ehe er sie packte und mit sich zur Erde riss. Der Koffer blieb auf dem Weg liegen, sie beide pressten sich aneinander in dem engen Graben, die Hände an den Kopf gedrückt, um sich zu schützen vor der Angst und dem höllischen Lärm, den die Mutter aus der Großstadt kannte. Nacht für Nacht war sie vor ihm in den Keller geflüchtet, als sie noch in der Stadt lebte.
„Jetzt kommen die Bomben“, flüsterte sie gepresst, „jetzt kommen gleich die Bomben.“ Und schon hörten sie, etwas entfernter, jenseits des Waldes eine Bombe niedergehen, ein Geräusch, von dem sie sich hier befreit geglaubt hatten.
„Wir müssen zurück“, sagte der Onkel, half ihr aus dem Graben, packte erneut den Koffer und führte sie, sie vorsichtig am Ellenbogen fassend, zurück in das überfüllte Haus mit all den alten Verwandten.
Und hier musste sie nun ihr Kind gebären, in der Aufregung über die Flieger und den Bombenabwurf, der Angst, sie kämen zurück, der Enge, in der sie seit Monaten lebten, und dem Unbehagen, das sie inmitten dieser Menschen spürte, von denen sie annahm, sie würfen ihr das Ungeborene vor. Auch hier war sie nicht sicher vor dem Krieg, das wusste sie nun.
Da man fürchtete, dass die Flieger zurückkamen, eilte man sich, ihr im Stall des Hauses, in dem keine Tiere mehr standen, ein Lager zurechtzumachen, auf dem sie entbinden konnte. Ihre Mutter und eine alte Tante standen ihr bei. Und während sie nun wartete, erinnerte sie sich der schönen Zeit ihrer ersten Liebe, der Leidenschaft des Soldaten, der an die Front zurück musste, sie erinnerte sich dieser wenigen sonnigen Tage, in denen sie sich frei und ganz jung gefühlt hatte. So verliebt – und kein Krieg spürbar, vergessen, vergessen für diese kurze Zeit!
In der Dämmerung dieses Märzabends neun Monate später gebar sie ihr erstes und einziges Kind, eine Tochter, der sie nie den ersten Platz in ihrem Leben geben konnte. Das schaffte sie nie – dafür hatten zu viele auf ihren Bauch gestarrt.
.......

Dieser Roman erscheint am 1.12.2012 im AAVAA Verlag, Berlin.
Hier der Anfang dieses Romans:
Es war wie immer, ihr ganzes Leben lang. Nach einer längeren Zeit hatten sie sich wieder einmal bei der Mittleren getroffen, miteinander Kaffee getrunken, ein wenig geplaudert und waren dann in die Werkstatt gegangen. Das taten sie gewöhnlich, wenn sie einander sahen. Und dabei taten sie alles, die gefährlichen Themen auszuklammern. Vorsichtig, abwartend, fast ein wenig lauernd waren sie miteinander umgegangen, mögliche Untiefen mieden sie. Sie kannten sie ja, sie kannten sie ja so gut nach all den Jahren, die sie nun schon Schwestern waren!
Und doch, dort in der Werkstatt war es wieder geschehen, heute, trotz der Mühe, die sie sich gegeben hatten! Sie standen vor einer der kleinen Kommoden aus Rosenholz, braunrot, auf schlanken Beinen, auf die die Mittlere sich spezialisiert hatte. Nachdem sie sie aufmerksam gemusterte hatte, zog die Ältere eine der kleinen Schubladen auf und schloss sie wieder, mehrere Male, kämpfte scheinbar gegen einen Widerstand an. Die Jüngste stand mit geschlossenen Augen da, lächelte verträumt und strich mit der Hand leicht über die Glätte des Holzes.
Und da war es geschehen, genau in diesem Moment, ohne dass eine von ihnen hinterher hätte sagen können, wer das erste falsche Wort gesagt oder wie es angefangen hatte. Es war wie immer. Nun gab ein Wort das andere, schonungslos, man kannte die Wunden der anderen, man wusste, wo man zustoßen konnte. Und es ging um die Mutter, immer ging es um die Mutter, um die Schwächen, die Versäumnisse, die Lieblosigkeiten. Nur sie allein habe sich um die Mutter gesorgt, als diese krank und hilfsbedürftig gewesen sei, beklagte die Älteste mit der klirrenden Stimme, die die beiden anderen zu hassen gelernt hatten. Jeden Tag sei sie zu ihr gegangen, wirklich jeden Tag, bekräftigte sie, indem sie mit der rechten Hand dreimal auf die kleine Kommode schlug, so dass die Jüngste, deren Finger immer noch über das Holz strichen, erschrocken hoch fuhr. Sie habe der Mutter in der Wohnung geholfen, geputzt, aufgeräumt, das Bett aufgeschlagen. Das Essen habe sie ihr gerichtet, gewärmt, darauf geachtet, dass die Mutter es zu sich nahm. Aber das, das sei ja der Mittleren ganz gleichgültig gewesen, die habe sich „in der Welt rumgetrieben“, immer habe sie das gemacht, schon als ganz kleines Kind! „Abgehauen“ sei sie, damals als der Vater...“ immer abgehauen“. „Ich bin ja die einzige, die sich gekümmert hat“ – das waren die Worte, die die jüngere Schwester seit vielen Jahrzehnten in den Angriff trieben. Wütend strich sie sich das immer noch blonde Haar zurück, trat einen Schritt auf die Älteste zu, und: „Du... du“, keifte sie nun los, als müsse sie noch überlegen, wie sie die andere treffen könne, obwohl sie das doch seit Jahren geübt hatte. Das sei der Mutter alles viel zuviel gewesen, „das Getue“, damals. Bei ihr, der Mittleren, habe die sich immer beklagt, heimlich, weil man ja mit der Schwester „nicht reden“ könne. Nie dürfe sie tun, was sie wolle, habe sie gesagt. Immer müssten alle „nach deiner Pfeife tanzen“, warf sie der Älteren nun vor, heftig, unerbittlich. Ob sie vergessen habe, wie wohl sich die Mutter immer bei ihr, der Rumtreiberin, gefühlt habe? Jawohl, ganz zufrieden habe sie bei ihr an dem großen Terrassenfenster in dem hohen Lehnstuhl gesessen, ruhig, stillvergnügt habe sie die pickenden Vögelchen beobachtet und sich gefreut, dass sie ihren Frieden habe. Oder damals, als „die Kleine“ ihren Hörsturz gehabt und sich nach Bayern „abgesetzt“ habe, wer sei denn da bereit gewesen, die Mutter bei sich aufzunehmen, wochenlang?
Und damit war auch die Jüngste ins Visier der Vorwürfe geraten. Aufgeschreckt starrte sie mit ihren grünen Augen, die so an diejenigen des Vaters erinnerten, die Schwestern an, die plötzlich zusammen gerückt waren und eine Front gegen sie bildeten. Sie wich einen Schritt zurück, duckte sich leicht und lehnte sich gegen die Wand, als könne sie nur so Halt finden vor den Vorwürfen, die nun auf sie einprasselten und die sie so gut kannte. Briefe habe man ihr schreiben müssen, immer wieder, an ihre Pflicht als Tochter habe man sie erinnern müssen, oft, „herbei zerren“, sonst wäre sie niemals zurück gekommen, hielt man ihr vor. „Aber“ ... und da stiegen ihr bereits die Tränen in die Augen und rollten wie bei einem Kind langsam die Wangen herab, ohne dass sie versucht hätte, sie abzuwischen, „aber...ich war doch auch krank...“, versuchte sie sich mit schwankender Stimme zu verteidigen. „Du wurdest gebraucht!“, schmetterte ihr die Älteste entgegen, jedes Wort deutlich einzeln artikulierend, ein dreimaliger Peitschenknall, der jedes Aufbegehren im Keim erstickte.
Man habe sich ja dann abwechselnd gekümmert, versuchte die Mittlere zu begütigen, zu spät. Es war zu spät, denn nun drang alles nach oben, was sie sonst so sorgsam unter Verschluss zu halten versuchten, wie immer. Alle Ungerechtigkeiten, Verletzungen und vermeintlichen Verfehlungen von über sechzig Jahren warfen sie einander vor, unnachsichtig, heftig, gnadenlos, bis die Jüngste die Hände vor die Augen schlug, laut aufschluchzte und aus der Werkstatt auf die Toilette im Flur stürmte. Die beiden anderen verstummten, atmeten schwer und starrten hinter ihr her, aber keine von ihnen konnte sich entscheiden, ihr nachzugehen und beizustehen. „Jetzt kotzt sie wieder“, dachte die Älteste ohne Mitleid, „immer hat sie gekotzt, wenn’s eng wurde.“ Die Mittlere schwieg, blickte erst kurz die Schwester an, dann auf ihre Hände, entfernte ein wenig Dreck unter dem Daumennagel und schämte sich ein wenig. Sie schämte sich, weil es ihr wieder einmal nicht gelungen war, die Zuspitzung zu verhindern. Aber auch sie blieb wie die Älteste an dem Platz stehen, an dem sie dieser vorgeworfen hatte, man habe ihr ja nie etwas recht machen können. Und überhaupt, es sei doch sie gewesen, die die Mutter nicht habe gehen lassen wollen, als diese endlich – endlich! – habe sterben können. Da sei sie doch zum Arzt gerannt, damit der sie wieder belebe, sie! „Du kannst einfach nicht loslassen, nie, nichts!“
Und in diesem Augenblick war „die Kleine“, die diese Szene damals im Krankenhaus miterlebt hatte, nicht sie, die Mittlere, zusammen gebrochen und raus gelaufen.
Die Ältere schaute sie an, lange, ohne den Blick zu senken, griff dann ohne ein weiteres Wort nach ihrer winzigen Tasche an der Goldkette, streifte sich langsam, betont, die hellbraunen Lederhandschuhe über, rückte den gleichfarbigen Gürtel über der hellen Kostümjacke zurecht, straffte sich und verließ aufrecht, ohne nur ein wenig auf ihren hohen Absätzen zu schwanken, das Schlachtfeld, ja, das Schlachtfeld, denn ein solches war die Werkstatt geworden. Die Tür knallte laut hinter ihr ins Schloss.
Die Mittlere blickte ihr nach, hilflos, schuldbewusst und zornig zugleich, griff dann gedankenverloren zum Hobel, streifte sich rasch den grauen Arbeitskittel über und ging zu der Werkbank vor dem Fenster. Mit einer raschen Bewegung fegte sie das Sägemehl, das dort lag, zur Erde und schien dann konzentriert die Maserung des vor ihr liegenden Holzes zu betrachten. Dabei aber horchte sie angestrengt in den Flur, wo sie das nervöse Hüsteln ihrer jüngeren Schwester hörte. Sollte sie ...?
Aber dann konnte sie sich doch nicht überwinden, sondern blieb vor der Werkbank stehen. Durch das Fenster sah sie, wie „die Kleine“, kleiner als die beiden anderen und etwas stämmiger, die langen grauen Haare unordentlich am Hinterkopf zusammengezurrt, mit hängenden Schultern langsam und zögernd das Grundstück verließ. In weitem Abstand folgte sie der Ältesten, obwohl die beiden doch den gleichen Weg gehabt hätten. Immer noch wohnten sie in unmittelbarer Nähe zu der alten Familienwohnung. Nur sie war weg gegangen von dort, lange schon, und lebte nun mit ihrer Familie auf der anderen Seite des Flusses.
Es war wie immer gewesen.
1. Teil: die Kinder
Ihr ganzes Leben lang hatte sie das Gefühl verfolgt, ihre glücklichste Zeit sei an jenem Januartag des Jahres 1943 zu Ende gewesen, an dem ihre kleine Schwester geboren worden war. Fünfzehn Monate war sie damals alt gewesen, sie Helga, Hella genannt, Mamas kleiner Liebling und Papas Stinkeprinzesschen, wie er immer lachend sagte, wenn er an ihren Windeln roch und sie dabei kitzelte, bis sie vor Vergnügen kreischte. Und nun lag da plötzlich dieses Baby in der alten Wiege, die man in Frohnhausen von dem Dachboden geholt und in dem Zimmer aufgestellt hatte, in dem sie mit ihrer Mutter untergekommen war. Das sei ihre kleine Schwester, sagte man ihr, ob sie sich freue. Sie sei nun „die Große“ und müsse gut auf die Kleine aufpassen, denn die könne noch gar nichts, sie aber schon so viel.
Mit gerunzelter Stirn, den Daumen fest im Mund, starrte Hella vom Arm ihrer Tante auf das glatzköpfige Etwas hinunter, das von irgendwoher gekommen und von irgendwem in diese Wiege gelegt worden war. Ein zum Schreien verzogener riesiger Mund, fest zusammen gekniffene Augen und zwei wild herum fuchtelnde Fäustchen, das war alles, und zu so etwas sollte sie lieb sein! Warum denn? „Das da“ hatte ihrer aller Leben genügend in Unruhe versetzt, das hatte – so klein sie auch noch war – Hella ganz instinktiv verstanden.
Die Mutter hatte ihr erzählt, dass sie bald „ein Geschwisterchen“ bekommen würde, und dabei hatte sie still gelächelt oder den Vater angestrahlt und immer ihre Hand wie beschützend vor ihren Bauch gehalten. Vorsichtig solle Hella sein, den Bauch dürfe sie nicht treten, da sei doch das Geschwisterchen drin! Dann jedoch hatte der Vater sie immer hoch in die Luft gehoben und im Kreise gedreht, und dann war sie wieder die Stinkeprinzessin, der kleine Liebling.
Aber zwei Monate, ehe die Mutter niederkommen sollte, hatten die Eltern beschlossen, dass es zu gefährlich sei, in Köln zu bleiben. Die Luftangriffe häuften sich, mitunter musste man mehrmals wöchentlich in den Luftschutzbunker, und in den Häuserfronten ihres Viertels in Köln-Deutz klafften – besonders seit der „Weihnachtsüberraschung“ am 27.12.1941 – zahlreiche Lücken. Johann Winter, der Vater, sorgte sich um seine Frau und das Ungeborene, aber auch um die kleine Helga, die damals, bei dem hundertsten Luftangriff, gerade einmal zwei Monate alt gewesen war. Und so entschied man, dass Trude mit ihrer kleinen Tochter in ihre Heimat fahren sollte, zu ihrer Schwester...

Mein vierter Roman "Die rote Lene" ist im September 2013 in dem alcorde Verlag in Essen erschienen:
Hier der Anfang des Romans:
Motto: „Wir sichern uns die Heimat nicht durch den Ort, wo, sondern durch die Art, wie wir leben.“ Georg Baron von Örtzen)
Wie immer sitzt sie in der viertletzten Bank links, dort wo die Frauen sitzen, ganz am Rand. Jeden Tag sitzt sie dort, seit zweiunddreißig Jahren, als sei dies der Ort, an den sie gehört, der für sie vorgesehen ist. Alt ist sie geworden, und alt fühlt sie sich auch. Alles fällt ihr schwerer als früher, allein kann sie die Arbeit nicht mehr bewältigen, ihre Bewegungen sind langsamer geworden und ihre Gedanken auch.
Meist geht sie nach der Mittagszeit mit unsicher gewordenen kleinen Schritten das kurze Stück die Hauptstraße hinauf, steigt die drei Stufen zur Kirche empor, betritt diese durch die etwas quietschende Seitentüre und steuert ihren Platz an, dort am Rand.
Ihr kommt es vor, als habe sie ihr ganzes Leben dort gesessen, 74 Jahre lang, nur dass es diese Kirche damals ja noch gar nicht gegeben hat. Und doch scheint er ihr so passend, dieser Ort, an dem sie sitzen muss, wann immer es ihr möglich ist. Dort ist sie willkommen, nur dort, denn zur Messe sucht sie die Kirche ja nie auf, nicht mehr seit..., aber daran mag sie gar nicht denken. Aus ihrer Schürzentasche zieht sie den Rosenkranz: fünfzig weiße Perlen, fünf weitere, die wie Granat leuchten. Sie muss lächeln, als sie die kleine Kette mit dem silbernen Kreuz und den drei Kügelchen berührt, an der das tägliche Gebet beginnt. Klaas hat gewusst, dass Granat ihr Lieblingsstein ist, und er hat ihr geschrieben, der Papst habe diesen Kranz gesegnet, für sie, die Schulfreundin, an die er immer denke und für die er bete dort in dem fernen Rom, das schon so lange seine Heimat ist. In die Erinnerung verloren senkt sie ihren Kopf mit dem stumpfweißen Haar, wie es ehemals Rothaarigen zu eigen ist, zu den Perlen, lässt ihren Zeigefinger zärtlich über eine der roten gleiten, immer wieder, hin und zurück und verliert sich in ihren Gedanken, eine ganze Weile lang. Erst als sie ein plötzlicher Sonnenstrahl – es ist bedeckt und grau dort draußen – trifft, schaut sie auf, schlägt das Kreuzzeichen und beginnt mit dem Glaubensbekenntnis, ganz selbstverständlich und durch die tägliche Gewohnheit tief vertraut. Dabei heftet sie ihren Blick auf das zweite Fenster links vom Altar, dessentwegen sie so häufig hier weilt, das sie immer anschauen muss, wenn sie den Rosenkranz betet. Dort ist sie, die Patronin der Kirche, Maria, die Gottesmutter mit ihrem Sohn, der aufrecht auf ihrem linken Arm sitzt. „Ejentlich geht dat gar net“, hat Louise gesagt, als die Fenster vor über dreißig Jahren geweiht wurden, „dat Kend müsste fallen. Su hält mer keen Kind!“, aber das ist ihr, Lene, egal. Wichtig ist nur, dass Mutter und Kind beisammen sind auf diesem Fenster, umrahmt von dem Gotteshaus und sechs Engelchen. Drei, die an einer Feldsteinmauer lehnen, wie sie im Dorf so häufig sind, scheinen neugierig wie kleine Kinder, die verstohlen etwas beobachten, was sie nicht kennen. Lene hat immer lächeln müssen, wenn sie in diese gespannten Gesichtchen schaute. Noch besser aber gefallen ihr die drei anderen, der kleine Flötist zu Marias Seiten und die beiden zu ihren Füßen. Stets hat sie gedacht, dass diese drei so fröhlich musizieren, weil der Sohn geboren ist: „den du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast“, ihr Lieblingsgeheimnis. Ganz versunken schlägt der eine die Trommel mit seinen Schlägeln, hin und her, weiß und schwarz, immer im Wechsel., während der andere auf der Kniegeige fiedelt: „Nun singet und seid frohohoh“ tönt es in ihr. Als sie Klaas davon erzählt hat – bei ihm hat sie keine Scheu, ihm kann sie fast alles erzählen, er verdammt nie – hat dieser laut gelacht, ihr erklärt, die „Kniegeige“ heiße Viola da Gamba, sie ein „Närrchen“ genannt, etwas von „zu viel Geschichten“ gemurmelt und ihr das rote Haar verstrubbelt, so dass auch sie lachen musste. Das hatte sie damals fast nie getan, gelacht, dafür war alles zu schwer, zu unverständlich, zu bedrückend. Es wollte auch niemand mit ihr lachen, damals, als sie seit gerade einmal seit fünf Jahren wieder in Mittelhof war, eine Fremde in der Heimat, nicht willkommen, gemieden, misstrauisch beäugt. Nur der Madonna war sie willkommen gewesen, das hatte sie immer gewusst, und so saß sie auch heute, wie jeden Tag, den Rosenkranz murmelnd, an ihrem Platz dort am Rande.
Klaas
Es ist seltsam, aber immer, wenn ich an Lene denke, steigt dieses Bild in mir auf, damals im Herbst, zwei oder drei Jahre vor der Jahrhundertwende. Wir müssen wohl acht oder neun Jahre alt gewesen sein.
Im Herbst hatten wir Kinder immer ein wenig mehr Zeit für uns, da die Ernte eingefahren ist und die Felder und Wiesen nicht mehr allzu großer Aufmerksamkeit bedürfen. In diesen Wochen hüteten wir Kinder nur das Vieh auf den Weiden und überboten uns darin, wer des Abends das schönste Feuer machen könnte.
So muss es auch an diesem Tag gewesen sein, an den ich mich so lebhaft erinnere. Wie so oft hatte ich, der einsame Junge aus Neudorn, mich den anderen Kindern in Mittelhof angeschlossen und sie und das Vieh auf den Teufelsbruch begleitet. Während die Kühe weideten – sie fanden noch genug Nahrung dort – hatten wir begonnen, kleine Zweige und Blätter zu sammeln. Außer mir und Lene waren noch Stürmers Louise und zwei weitere Mädchen zugegen, etwas jünger als wir drei. Unter dem dunklen Herbsthimmel schwärmten wir Fünf also aus, möglichst viel brennbares Material zu der Stelle zu schaffen, wo unser Feuer lodern sollte, höher als das der anderen. Ich war bis an den Waldrand gegangen, weil ich mir dort trockene Ästchen erhoffte und näherte mich auf dem Rückweg den vier Mädchen, die mitten auf der Wiese standen, weit genug von dem weidenden Vieh entfernt, um es nicht zu schrecken. In meiner Abwesenheit hatten sie einen riesigen Haufen von trockenen Blättern zusammengesucht, gelb, rot, orange, grün und braun, den sie zu einer Pyramide aufgeschichtet hatten. Louise hielt den großen Korb, in dem sie gesammelt hatte, noch in den Händen und schaute mir abwartend entgegen, was ich wohl brächte, während das größere der beiden anderen Mädchen mit Schwung noch eine Handvoll Blätter auf die Pyramide warf. Neben ihr stand die Kleinste, nicht braunhaarig wie die beiden größeren, sondern blond, und blickte ganz versonnen, selbst vergessen einen angebissenen Apfel in der Hand, auf die aufgetürmten Blätter, die fast so hoch waren wie sie selbst. Diese drei dunkel und einfach gekleideten Mädchen – lange dunkle Flachsröcke, gestrickte schwarze oder blaue Jacken darüber – bildeten einen Halbkreis um unsere Pyramide, die gleich aufglühen sollte. Außerhalb dieses Halbkreises, etwas nach links versetzt, stand Lene in ihrem gewohnten rotbraunen Kleid, einen Stecken in der Hand, mit dem sie wohl das Material zusammen gescharrt hatte. Nachdenklich blickte sie irgendwohin, ich weiß nicht zu sagen, was sie sah, aber sie schien nicht auf die Pyramide zu schauen, die die Aufmerksamkeit der anderen gefesselt hatte. Und in diesem Augenblick erhellte sich der bisher dunkle Himmel durch ein paar abendliche Sonnenstrahlen, die Lene trafen, die dort außerhalb des Kreises stand. Ihr glattes rotes Haar, das sie zu dieser Zeit kurz trug, leuchtete auf, ihre ganze Gestalt schien in Licht gehüllt, bis sich dann wieder Dunkelheit über die Gruppe senkte.
Ich weiß nicht, was ich empfunden habe, ich weiß nur, dass sich mir dieses Bild so eingeprägt hat, dass es immer wieder aufsteigt, wenn ich an Lene denke. Ich nehme an, dass wir unser Feuer entzündet haben, die vier Mädchen und ich. Wahrscheinlich hatten wir auch Kartoffeln mitgenommen, die wir in die Glut schoben und später genüsslich aßen. Und wahrscheinlich haben wir auch an diesem Abend laut und fröhlich das Lied gesungen, das wir stets sangen, wenn wir das Vieh beim abendlichen Glockenläuten heimwärts trieben:
„Hemo! Hemo! Modder, schmer mr en Dong!
Kloppen mir off d’n Müllesteen,
Loofen de Köh all’ no hem.
Hemo! Hemo! Modder schmer mr en Dong!“
Dieses Lied sang ich auch immer vor mich hin, wenn ich mich dann in der Dunkelheit auf meinen langen Heimweg machte, den steilen Weg abwärts die Grabigshardt entlang, durch Grabigshütte, dann den stetig ansteigenden Weg durch die Wiesen am Hümmerich bis Neudorn, wo ich mit meinen Eltern wohnte. Diesen Weg werde ich auch an jenem Abend gegangen sein, von dem ich erzählt habe, und ich denke, ich werde dieses Bild erst einmal vergessen haben, bis es irgendwann einmal wieder in mir aufstieg.
Sicherlich war ich auch sehr empfänglich für dieses Erlebnis. Heute weiß ich, dass das, was Lene und mich verband und heute noch verbindet, unsere jeweilige Andersartigkeit war. „Die „ruure Lene“, wie sie gerufen wurde, der „Rotschopf“, „Feuerkopf“, „Fuchs“ war anders. Wer hatte schon rote Haare in Mittelhof? Und wer im Westerwald hieß Klaas, wie ich?
Damals lebten meine Eltern erst seit kurzer Zeit mit mir in der Abgeschiedenheit Neudorns, wo kaum einmal jemand hinkam und wo es heute, im Jahre 1963, immer noch kein fließendes Wasser gibt. Wir lebten in einem winzigen Lehmkotten: Küche und zwei kleine Kämmerchen. Um das Häuschen herum hatte meine Mutter einen Gemüsegarten angelegt, in dem sie mehr schlecht als recht versuchte, zu unserem Lebensunterhalt beizutragen. Aber ihre Hände, die das Klavierspielen und Kalligraphieren gewöhnt gewesen waren, sträubten sich gegen die Garten- und Hausarbeit. Das hatte sie nie gelernt, aber nun musste sie es tun, nun, da sie diese Mesalliance mit diesem „hergelaufenen holländischen Kerl“ eingegangen war, der mein Vater wurde. Meine Eltern hatten mir seit frühester Kindheit erzählt, wie sehr sie sich geliebt, dass es sie wie einen Strahl getroffen hatte, als sie einander zum ersten Male in Köln auf der Straße gesehen hatten. Ein „coup de foudre », so nannte es meine Mutter immer lächelnd, und dagegen helfe eben nichts, nicht der Widerstand ihrer Familie, nicht die Verbote, nicht die Enterbung. Und eines Tages war sie schwanger gewesen mit mir. Sie hatte ihren Holländer heimlich geheiratet, und sie mussten Köln und ihrer Familie den Rücken kehren. Irgendwann waren sie auf ihrer Wanderung hier im Westerwald gelandet, hatten den Kotten gemietet, in dem wir nun wohnten, und mein Vater hatte begonnen, in der Grube Friedrich als Bergmann zu arbeiten. Natürlich hätten sie es einfacher gehabt, wenn sie nicht gerade nach Neudorn gezogen wären, aber die Abgeschiedenheit dort hatte sie angezogen. Sie wollten für sich sein. Nie mehr wollten sie die Ablehnung der anderen Menschen erfahren. Und so nahm mein Vater alle Unbill in Kauf, machte sich tagtäglich auf den langen Weg zur Grube und zurück und lebte mit „meinen Liebsten“, der Mutter und mir, hier in dieser Einsamkeit. Ein weiteres Kind hatten sie nicht mehr bekommen, so dass alle ihre Hoffnungen auf mir ruhten, dem sichtbaren Zeichen ihrer Liebe. Auch ich liebte sie sehr, aber ich war immer ein einsames Kind, bisher nirgendwo zuhause gewesen, nur umgeben von diesen beiden, die einander alles bedeuteten. So war auch ich unendlich erleichtert, dass sie beschlossen, in Neudorn bleiben zu wollen, so lange es ihnen gegeben würde, denn es gab mir endlich die Möglichkeit, Kameradschaften mit anderen Kindern zu schließen.
Das aber war sehr schwierig. Allein mein Name, Klaas, machte mich verdächtig. „Wo kömmst du dann herr?“ war die erste Frage, die mir ein rotwangiger kräftiger kleiner Bursche stellte, als Lehrer Schmidt, der damals die Unterstufe betreute, mich vorstellte. Wo kam ich „dann herr?“, diese Frage trieb mir das Blut in den Kopf, und hochrot vor Verlegenheit stand ich vor mindestens fünfzig Augenpaaren, die mich neugierig musterten. Ich wusste ja selbst nicht, wo ich her kam, wir waren kaum sesshaft gewesen, aber das konnte ich diesen Bauernkindern, die von den umliegenden Höfen stammten, doch schlecht mitteilen. So senkte ich nur beschämt den Kopf und stolperte der freien Hälfte der letzten Bank zu, die der Lehrer mir anwies. Und dieses Stigma, nicht zu wissen, woher ich käme, schleppte ich seit meinem ersten Schultag mit mir herum. Die anderen wussten so genau, dass sie aus Durwittgen, Steckenstein, Blickhauserhöhe, Mittelhof, Krombach oder Röttgen kamen, dort hatten bereits ihre Eltern, Großeltern und wahrscheinlich auch deren Eltern gewohnt. Ich aber kam aus dem Nirgendwo, hatte eine Mutter, die kaum jemand je sah, und einen Vater, der ein ganz merkwürdiges Deutsch sprach. Auch mein strohblondes widerspenstiges Haar unterschied mich von ihnen, diesen Jungen und Mädchen, die jeden Vormittag von acht bis ein Uhr in dem großen Schulsaal an der Hauptstraße mehr oder weniger intensiv lernten.
Mir machte das Lernen Spaß, und obwohl ich vorher nie eine Schule besucht hatte, war ich meinen Mitschülern in kürzester Zeit voraus. Lesen und Schreiben hatte ich von der Mutter gelernt. Keine meiner vielen Kinderfragen war jemals unbeantwortet geblieben, so dass ich ein weit umfangreicheres Wissen über die Welt hatte als die Dorfkinder, die sich dafür viel besser in allen Fragen von Flora und Fauna auskannten.
Die ersten Schultage waren schwierig für mich, auch, weil ich es ja gar nicht gewöhnt war, immer von so vielen Menschen umgeben zu sein, inmitten des lauten Lärms, der heftigen Gerüche und der zahlreichen Augeneindrücke auszuharren. Erst ganz allmählich klärten sich mir die einzelnen Namen und Gesichter dazu, konnte ich eine gewisse Ordnung all dieser mich überwältigenden Sinneseindrücke herstellen. Und irgendwann fiel mir das schmale kleine Mädchen auf, das am Rande der dritten langen Schulbank saß, in die sich sechs Mädchen teilten. Sie wirkte ganz in sich gekehrt. Ihre Stimme hatte ich auch nach drei Wochen noch nie gehört.
Und dann kam diese Pause. Ich besuchte mittlerweile ungefähr fünf oder sechs Wochen die Schule in Mittelhof, war höflich und freundlich allen gegenüber, hielt mich aber zurück, weil ich erfahren hatte, wie schnell die gute Laune des kleinen rotwangigen Johannes, der so etwas wie der Anführer in der Unterstufe war, in Aggressivität und Gewaltbereitschaft umschlagen konnte, wenn man nicht nach seiner Pfeife tanzte. Er war der älteste Sohn des Hofes von Roddern, und manch einer hatte sich eine blutige Nase geholt, wenn Johannes’ Herrschaftsansprüchen nicht bereitwillig Folge geleistet wurde. So lange ich ihm keinen offensichtlichen Widerstand leistete, so lange konnte ich hoffen, Ruhe vor ihm zu haben. Das hatte die Mutter mir erklärt, und bis dahin war ich gut mit diesem Rat gefahren. An diesem Spätsommertag – die Luft war noch lau, der Himmel licht und blau – hatte uns der Lehrer wieder einmal für eine Pause „an die frische Luft“ geschickt, wie er zu sagen pflegte. Und so bewegten wir uns rund um das ehemalige Bauernhaus, in dem sich unten die Schulstube und oben die Kammern der Lehrer Contzen und Schmidt befanden, ein jeder nach seiner Art. Einige Jungen tobten schreiend über die Dorfstraße und ließen ihre Kräfte ins Kraut schießen nach diesen langen Stunden des ungewohnten Stillsitzens. Andere kickten Steine zwischen sich hin und her oder kletterten auf die Feldsteinmauer, die das Gehöft umgab, und kauten genüsslich ihre Butterbrote oder bissen in einen Apfel. In eine Ecke des Grundstücks hatten sich die Mädchen zurück gezogen, schwatzten, kicherten, einige banden Blumenkränze, die sie einander quietschend aufs Haar setzten und ließen keinen Jungen in ihre Nähe. Ich stand allein in meine Gedanken verloren am anderen Ende des Grundstücks, zur Straße hin, als sich plötzlich ein höllischer Lärm erhob. Aufblickend sah ich, dass die Jungenschar sich zusammen gerottet und einen Kreis gebildet hatte. Lauthals skandierte sie irgendetwas, erst nur vereinzelte Stimmen, dann immer mehr, rhythmischer werdend und akzentuierter. Und nun verstand ich auch, was sie schrieen: „Rübenkopf“, kam es von der einen Seite des Kreises, „Rotfuchs“ von der anderen, hin und her, bis aller Stimmen sich vereinigten und „Hex! Hex!“ schrieen, „Lene Hex, Hex!“. Den Stimmführer gab Johannes, der auf- und abspringend das Tempo der Rufe vorgab und immer schneller wie ein Derwisch wurde, bis das „Hex! Hex!“ stakkatoartig ertönte. „Hex! Hex!“ Hex! Hex!“ Als sich der Kreis ein wenig öffnete, konnte ich von der abseitigen Stelle aus, an der ich mich befand, erkennen, dass in seiner Mitte das kleine Mädchen stand, dessen Stimme ich noch nie gehört hatte. Aufrecht und ruhig stand sie da, ihr kurz geschnittenes rotes Haar glänzte in der Sonne, der Rock des rotbraunen Kleids, das sie immer trug, bauschte sich leicht im Sommerwind. Ihren Kopf hielt sie ganz aufrecht, was mich sehr verwunderte, hätte ich ihn an ihrer Stelle doch sicherlich zur Erde geneigt, aber nein, sie hielt ihn aufrecht und schaute. „Hex! Hex!“ Sie schaute. „Hex! Hex!“ Sie schaute immer noch, geradeaus, und ließ den Blick nicht sinken. Von hinten ertönte eine Stimme, die ich als diejenige der couragierten Louise erkannte: „Hürt off! Hürt off!“, aber die Jungen schrieen weiter. Ich ging einen Schritt auf die Gruppe zu und sah, dass Lene, die in deren Mitte stand, niemanden Bestimmten anschaute, sondern einfach nur ihren Blick standhaft hielt, geradeaus, tapfer und unbeirrbar. Irgendwann muss ich in ihren Gesichtskreis getreten sein, denn die Szene zog mich wie magisch an, und das war der Augenblick, in dem ich spürte, dass sie mich wahrnahm. Ich lächelte ihr zu, ganz einfach, ich musste diesem Mädchen zulächeln, das da so einsam den Spöttern die Stirn bot. Ich lächelte ihr zu, von einem Einsamen zu dem Einsamkeitskameraden. Sie schien zu verstehen, was ich ihr mitteilen wollte, denn ihr unbewegtes Gesicht verzog sich ein wenig, der kurze Anflug eines Lächelns glitt über ihre Züge, dann schaute sie wieder wie vorher ins Nirgendwo. Louise machte dieser Szene energisch ein Ende, indem sie sich vor Johannes aufbaute, die Arme in die Seiten stemmte und ihn anbrüllte: „Hür endlich off. Ich saan et soss!“ Da auch die anderen Mädchen sich nun dem Kreis näherten, trollten die Jungen sich einer nach dem anderen, und es kehrte wieder Ruhe ein.
Später erfuhr ich, dass die Rothaarige die Lene sei, „de ruure Lene vun de Häh“, einem Bauernhof ganz abseits und einsam gelegen, den ich in den kommenden Jahren noch oft besuchen sollte. Die Lene sei „komisch“ und sie sei eine Hexe, das sehe man an den roten Haaren. Alle Rothaarigen seien Hexen, das wisse doch jeder! Und ich schämte mich, dass ich nicht den Mut hatte zu widersprechen. Denn ich wusste ganz genau, dass das „Stuss“ sei, so hatte die Mutter es genannt, als ich ihr von der Szene erzählte, die mich tagelang beschäftigte.
Seit diesem Tage gab es so etwas wie eine Beziehung zwischen der Lene und mir, obwohl es eine ganz behutsame Annäherung zweier außen Stehender war, die miteinander nicht mehr allein sind. Zunächst tauschten wir nur hin und wieder ein Lächeln aus, standen wohl auch einmal des Morgens kurz beieinander, ehe der Lehrer uns in die Schulstube holte. Gesprochen haben wir damals, soweit ich mich erinnere, eigentlich nie miteinander, wir nahmen nur durch Gesten und Lächeln den Kontakt zueinander auf. Dann schenkten wir uns Äpfel, Beeren oder tauschten die Schulbrote, obwohl auf beiden das gleiche war: Butter und manchmal auch Marmelade. Ganz heimlich taten wir dies, als müssten wir es vor den anderen verbergen, und das war gewisslich auch besser so. Es hat wohl Wochen gedauert, bis wir zum ersten Male miteinander sprachen, und ich weiß noch, wie erstaunt ich über Lenes Stimme war: merkwürdig tief für ein solch kleines Mädchen, etwas rau. Sie sagte wenig. Ich erzählte mehr, denn ich hatte ein seltsames Vertrauen zu ihr gefasst, und sie hörte zu, wenn ich von den Wanderungen mit meinen Eltern berichtete, von dem Leben, das wir Drei geführt hatten, ehe wir uns in Mittelhof niederließen, den Städten und Flüssen, den Menschen und Ereignissen, die ich gesehen hatte. Und ihr konnte ich auch erzählen, dass ich lernen wollte, ganz viel lernen, und dann wollte ich etwas ganz Großartiges tun, etwas, das anderen Menschen hilft. Das war damals mein Lebensentwurf, auch wenn ein Kind gar nicht weiß, was dieses Wort bedeutet. Lene staunte. Mit weit aufgerissenen Augen saß sie neben mir im Gras, ihren rotbrauen Rock um sich gebreitet, hörte mir zu und konnte es nicht fassen. Was es alles gab auf der Welt! Aber Mittelhof sei auch „schüen“. Hier fühlte sie sich zuhause, auch wenn die anderen ihr das Leben oft schwer machten. Über die Schikanen in der Schule wollte sie nicht sprechen. Sobald ich darauf zu sprechen kam, lenkte sie schnell auf etwas anderes über, fragte nach meinem früheren Leben, und ich erzählte, sofort erzählte ich und wie unter einem Zwang. Zum ersten Male hatte ich jemanden für mich, der gleichaltrig war. Bisher hatte ich ja nur das Leben mit meinen Eltern gekannt.
Ja, so war das mit der Lene damals in der Mitte der neunziger Jahre, als wir uns in der Schule kennen lernten und stark zueinander hingezogen fühlten, der „Klaas von Nirjendwo“ und „de ruure Lene“.
Irgendwann nahm sie mich dann auch zum ersten Male mit in „de Häh“, den Ort, an dem sie mit ihrer Familie lebte. Jüngstes Kind von Sechsen war sie, das hatte sie mir erzählt, sonst aber nur sehr wenig. Dass der „Opa“, der Vater des Vaters, mit auf dem Hofe lebte, wusste ich, war aber überhaupt nicht auf diesen kantigen Zweiundachtzigjährigen vorbereitet, der mit finsterem Blick und in stets gebückter Haltung entweder des Sommers auf der Bank neben dem Hauseingang oder im Winter neben dem Ofen in der Küche saß und alles im Blick zu haben schien, was um ihn herum geschah. Von ihm ging etwas Bedrohliches aus, so empfand ich es als der Knabe, der ich war, als ich ihm meine rechte Hand hinstreckte, wie mich die Mutter gelehrt hatte, um ihn zu begrüßen. Weder nahm er die Hand noch schaute er mich an, sondern brummelte irgendetwas vor sich hin, das nicht sehr einladend klang. Schnell zog Lene mich fort von ihm in den Stall, wo sie mir zunächst die fünf Kühe, die die Familie hielt, zeigte und liebevoll jede einzelne begrüßte und ihr über den Kopf strich. Als ich zögerte – Tiere war ich nicht gewohnt, obwohl wir jetzt seit einem halben Jahre auf dem Lande wohnten – nahm sie wie selbstverständlich meine rechte Hand, legte sie auf die Blesse einer Rotbraunen und hielt sie dort sanft fest, als wollte sie mir zu verstehen geben, mir könne nichts geschehen. „Dat ess Rosi“, meinte sie nur, als sei damit alles gesagt, ließ meine Hand los, kraulte den Nacken des Tieres und murmelte beschwörend auf es ein. Ich staunte. Hier im Stall, das war eine neue Lene für mich. Eine, die sprach und fröhlich lachte, von allen tierischen Bewohnern des Hofes willkommen geheißen zu werden schien, selbst die Hühner versammelten sich um sie, als sie mit lockendem Rufen zu dem Geviert ging, das rechts neben dem Wohnhaus deren Revier bildete. Auf der anderen Seite wachte bellend und knurrend an der Feldsteinmauer, die den Garten von dem Hof abgrenzte, angebunden an seiner Hütte, der große und gefährlich aussehende Schäferhund, der in Lenes begrüßender Umarmung zum Schoßhund wurde. Das laute „Loss ess!“ einer hart klingenden Frauenstimme ließ Lene zwar kurz zusammenzucken, aber dann setzte sie ihr Streicheln unverdrossen fort. Wie ich später erfuhr, fand die Mutter ihre Tierliebe „üvverdriven“, ein Hund sei zum Aufpassen da und eine Kuh zum Milchgeben, „esu ess et!“
Das Fachwerkhaus der Familie kam mir damals – verglichen mit unserem kleinen Kotten – riesig vor, war aber für die große Familie, der es Unterkunft bot, recht beengt. Die Haustüre auf der Giebelseite führte in einen langen Flur mit mancherlei bäurischem Gerät, von dem aus man auf der rechten Seite in die Küche, auf der linken in „de Stuff“ gelangte. Hinten schlossen sich die Ställe, Futter- und Vorratskammer an. Über eine steile Stiege gelangte man in die schmalen Kammern der ersten Etage, die zum Schlafen und zum Aufbewahren der Feldfrüchte, der geräucherten Schinken und Würste dienten. Alle Fenster waren klein, so dass es im Haus immer dämmrig war, genau wie bei uns in Neudorn. Durchzogen waren alle Räume vom Geruch der Kühe, Schweine und Hühner, des Heus, das oberhalb der Ställe gelagert wurde und des gärenden Viehfutters, das mir immer ekelhaft „stinkig“ vorkam, was Lene, sonst Gerüchen gegenüber empfindlich, überhaupt nicht wahrnahm, war sie diese doch von Kindsbeinen an gewöhnt.
Hinter dem Hause – abgetrennt durch die lange Feldsteinmauer – lag der Garten, ein Paradies. Leicht hügelig erstreckte er sich über die ganze Länge des Gehöfts. Kräuter- und Gemüsegarten lagen unmittelbar in seinem Schatten, ordentliche kleine Beete, durch niedrige Buchsbaumhecken voneinander getrennt, und dahinter begann Lenes Paradies, wie sie später, im Rückblick auf ihre Kindheit, stets zu sagen pflegte, „min Paradies“. Nicht gleich bei meinem ersten Besuch, der im Spätherbst stattfand, sondern erst im darauf folgenden Sommer, als ich bereits viele Tage und auch Nächte in „de Häh“ verbacht hatte, zeigte sie mir ihren Lieblingsplatz. Einen ihrer Lieblingsplätze, wie mir heute klar ist, den anderen hat sie mir nie verraten, den hat ein ganz anderer als ich kennen lernen dürfen und für seine Zwecke benutzt. Aber ich bleibe bei dem Sommer unserer Kindheit, in dem Lene, geheimnisvoll lächelnd, mir nach der Arbeit im Stall, die uns beiden übertragen worden war – auf einem solch kleinen Hof arbeiten alle mit, auch die schulpflichtigen Kinder – winkte, ich solle ihr folgen, unbemerkt von den anderen und schnell. Wir beide hasteten barfuss über den Hof, vorbei an der Hundehütte und liefen in den Garten. Eilig öffnete Lene das niedrige Holztürchen, das Gemüse und Kräuter von den Wiesen und dem Obstgarten trennte, und stürmten hügelan, so flink, dass ich ihr kaum folgen konnte. Mitunter war sie so schnell, das kaum ein anderes Kind es mit ihr aufnehmen konnte. Ihr rotbrauner Rock flatterte, und die beigefarbene Bluse, die sie heute dazu trug, rutschte aus dem Rockbund, so dass sie den Blick auf ein schon recht dunkelweiß aussehendes Unterhemd frei gab. Birnen-, Quitten-, Pflaumen-, Kirsch- und Apfelbäume standen verteilt auf diesen Wiesen, die sich aufwärts in Richtung „Stuhl“ zogen, aber Lene ließ sich nicht aufhalten, sondern verschwand hinter einer Hügelkuppe. Und dann sah ich ihn, Lenes Lieblingsplatz, sie sah ich nicht mehr. In einer kleinen Senke, die sich aufgetan hatte, stand ein riesiger Apfelbaum mit mächtiger Krone, die dicken Äste breit gestreckt, das grüne Laub bis fast zum Boden. So weit war ich noch nie in die Tiefen des Gartens gelangt und stockte nun, als ich den Baum in all seiner Majestät – ja, Majestät, anders kann ich es nicht ausdrücken - dort unter mir stehen sah. „Kumm!“, hörte ich ein Locken und noch einmal: „Kumm!“ Und da rannte ich los, bis ich atemlos an dem Stamm ankam und irgendwo über mir einen sich bewegenden rotbraunen Fleck wahrnahm. Beim nächsten „Kumm!“ versuchte ich den niedrigsten Ast zu ergreifen und mich daran hochzuziehen, was mir gar nicht so leicht fiel, war ich doch mit meinem Kopf immer flinker und geschickter als mit meinen Händen. Irgendwie gelang es mir, und endlich erreichte ich etwa in der Mitte des Stammes die Astgabelung, in der Lene es sich bequem gemacht hatte und von der aus sie mir eine Hand zur Hilfe entgegen streckte. Froh, es geschafft zu haben, ließ ich mich auf der anderen Seite des Stammes nieder und blickte empor. Nur Grün sah ich, lauter Grün, dicht, den blauen Sommerhimmel konnte ich nur ab und zu einmal durchblitzen sehen. Und hier, an diesem Nachmittag, erzählte Lene mir, der Baum sei ihr Freund. Keiner komme auf der Suche nach ihr so weit in den Obstgarten, hier vermute sie keiner. Also sei sie sicher hier, „vor allen und vor allem“, sagte sie fast heftig, ohne zu erklären, was sie damit meine, wie ja Erklären sowieso nie Lenes Sache war, nie. Verstand man sie, war es gut, tat man es nicht, kümmerte sie sich nicht darum. Ich hatte das Glück, sie meist zu verstehen und war deshalb ihr Freund, wie dieser Baum, der sie vor allem Feindlichen beschützte. Das hätte ich auch allzu gerne getan, konnte es aber nicht, als es darauf ankam, und das schmerzt mich noch heute. Ich habe nicht verstanden, dass sie alles zu dem Fremden hinzog, vielleicht mochte ich sie auch mit niemandem teilen, mag sein, aber hätte ich es wirklich verhindern können?
Zu allen Jahreszeiten fühlte sich Lene zu diesem Baum weit abseits von dem Haus hingezogen: in der Blütenpracht des Frühlings, der Reife des Sommers, der Buntheit im Herbst und der asketischen Schönheit des Winters, die mir am besten gefiel. Entweder saß sie hoch oben in der Astgabelung, in der wir an jenem Sommertag gehockt und erzählt hatten, oder sie lag unter ihm im Gras und schaute in die Blätter über ihr. Es konnte auch geschehen, dass sie auf ihn zueilte und seinen Stamm umarmte, auch wenn sie ihn natürlich nicht ganz umgreifen konnte, mächtig wie er war. Ich weiß, dass er ihre Tränen sah, aber daran hat sich mich nie Anteil nehmen lassen. Sie blieb allein, wenn sie weinte. Wir beide haben viel Zeit bei diesem Baum verbracht, stahlen uns fort zu ihm, wann immer wir einige Minuten erübrigen konnten – auf einem Bauernhof gibt es viel zu tun, da gibt es keine Zeit für einen selbst, wie ich sie gewöhnt war, weil meine Eltern alles taten, um meine Studien zu unterstützen. Auch sah ich meine Mutter mitunter tatenlos auf der Bank vor unserem Kotten sitzen, in ihre Gedanken verloren. So habe ich Lenes Mutter nie gesehen. Deren Hände ruhten nie, weder im Sommer noch im Winter, weder des Tages noch in der Dunkelheit. Lenes Familie lernte ich auch dadurch näher kennen, dass mir ihr Vater, dem ich bei meinen Besuchen so gut als möglich, zur Hand gegangen war, sagte, ich könne im Winter, wenn der Weg nach Neudorn kaum zu bewältigen war, bei ihnen übernachten, in einer der oberen Kammern stehe immer eine leere Bettstatt, ich solle meine Eltern fragen, ob sie damit einverstanden seien. Und so wurde es allmählich zu einer Selbstverständlichkeit, dass ich, wenn der Schnee allzu hoch lag, um mich durch die Grabigshardt zu kämpfen, in „de Häh“ blieb, selbst der Vater blieb die eine oder andere Nacht dort, wenn er aus der Grube kam.
Das waren dann die Tage, an denen man kaum bis zu dem Gehöft von Lenes Eltern vordringen konnte und der Schulsaal recht leer blieb, weil die Kinder, die von weit her kamen, die Schneemassen nicht bewältigen konnten. Lene und ich gingen dann die Hauptstraße hoch bis zu der Kreuzung, an der später die Kirche gebaut wurde, wandten uns dort nach rechts und stapften den kleinen Weg zum „Stuhl“ hoch. Den Pfad, der zum Quadenhof führte, ließen wir rechts liegen und kämpften uns durch die Schneemassen bis zur Anhöhe hinauf, von der aus man Mittelhof unter sich liegen sieht. Dort mussten wir uns nach rechts wenden und noch mehr als einen Kilometer hügelabwärts zunächst durch Wiesen, dann durch ein kleines Wäldchen und endlich an den Hecken vorbei, die dem Gehöft den Namen gegeben hatten, wandern, bis wir in „de Häh“ ankamen. Leichter war es, wenn an diesem Tage ein Fuhrwerk bereits einen Weg gebahnt hatte, dann konnten wir versuchen, in den Karrenspuren zu gehen und schneller vorwärts zu kommen. Ich war dann immer froh, wenn wir in der Küche an dem wuchtigen Holztisch mit den anderen saßen, Berge von Bratkartoffeln vertilgten, unter die mitunter kräftig Speck gemischt worden war. Danach half ich allzu gerne im Stall mit aus, denn dann fühlte ich mich all denjenigen zugehörig, die „de Häh“ ihr Zuhause nannten, eine dieser vielen kleinen Bauernschaften, wie es sie am Ende des 19. Jahrhunderts so häufig im Westerwald gab und der ich mich dank Lene zugehörig fühlen durfte für viele Jahre.
Lene
„Et ess doch nur wirrer en Mädchen“, hat der Großvater gesagt, als ich am 25. Februar 1889 geboren wurde, zweimal hat er es gesagt: „Et ess doch nur wirrer en Mädchen“, und alle haben gewusst, was er von mir hielt. Und meine Brüder haben laut gesungen: „Müller, Müller, mahle, die Jongen kosten nen Taler, die Mädchen kosten nen Taubendreck, die fihrt ma mit der Schubkarr weg“: Das hat den Dreien Spaß gemacht, denn der Großvater hat laut gelacht – bestimmt hat er gelacht dabei, das hat er immer getan, wenn einer mich schlecht machte – und der Vater hat auch nicht widersprochen. Das hat er nie getan, weder der Mutter noch dem Großvater gegenüber, der immer noch das Sagen auf dem Hof hatte. Vierundsiebzig Jahre ist er damals gewesen und zweiundachtzig ist er geworden. Das war für mich uralt. Furchtbare Angst habe ich vor ihm gehabt, wenn er draußen auf der Bank oder in der Ofenecke saß und mir mit grimmigem Blick nachsah. Ich habe es nie verstanden, wenn er etwas zu mir sagte, seine Stimme polterte und knarzte so, da habe ich immer einen Schrecken bekommen und bin ganz schnell weggelaufen. Am schlimmsten war es, wenn er manchmal nett zu mir war und mich zu sich heranzog. Immer roch er schrecklich nach Schnupftabak, und lange graue Haare wuchsen ihm aus der Nase. Die musste ich immer anstarren und konnte nicht wegsehen, wie angewachsen stand ich dann vor ihm und ekelte mich. Ganz selten strich er dann mit seiner großen schwieligen Hand über meine Haare, murmelte „Feuerkopf“ oder „Hexe“ und schob mich fort. Dann bin ich immer ganz schnell in den Stall oder zu meinem Baum gelaufen, da war ich sicher, da kam er nicht hin.
Ich war das sechste Kind in unserer Familie, das am Leben blieb.. Drei ältere Brüder, Albert, Peter und Johann, und zwei ältere Schwestern, Rosa und Maria, gehörten noch zu unserer Familie. Die Mutter war schon neununddreißig Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Mit mir hatte sie gar nicht mehr gerechnet, hat sie mir einmal erzählt. Nach dem Johann, der sieben Jahre älter war als ich, wollte sie eigentlich kein Kind mehr, fünf waren genug, und es gab ja auch viel Arbeit. Aber dann bin ich eben doch noch gekommen, so hintendrein, und dann noch auf Matthias! Nicht „nur ein Mädchen“, sondern auch noch ein „Matthias-Kind“, das war arg. Vor den Matthias-Kindern fürchteten sich alle ein wenig, sie waren ihnen ungeheuer, denn sie konnten „Dinge sehen“. Im Dorf hat man immer erzählt, dass eine am 25. Februar geborene Frau irgendwo bei Wissen ein Feuer vorher gesagt hatte, eine andere hatte die schwere Erkrankung ihres Mannes gesehen. Und sie konnten genau sagen, wer im nächsten Jahr sterben würde, wenn sie die Mitternachtsstunde ihres Geburtstages auf dem Friedhof verbrachten.
Ob das stimmt, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich mich unheimlich gefürchtet habe, als Peter, der Bruder, mit dem ich es am wenigsten konnte, mich dazu gezwungen hat, eine Nachtstunde auf dem Kirchacker in Mittelhof zu verbringen. Fünf oder sechs Jahre muss ich alt gewesen sein, als er mich in einer Nacht geweckt und nach draußen gebracht hat. Es lag noch Schnee, und ich erinnere mich daran, dass der Weg von „de Häh“ nach Mittelhof ganz schwierig war. Immer wieder bin ich ausgerutscht, und immer wieder hat er mich hoch gezerrt und weiter gezogen. Das Tuch, das er mir gegen die Kälte gegeben hat, rutschte dauernd runter, ich weinte und mir war kalt. Ich wollte wissen, was er vorhat, aber er sagte nichts, sondern guckte nur grimmig und rief: „Komm! Komm!“ Als wir dann auf dem Friedhof angekommen sind, hat er unter einem Baum einen Sack hingelegt, mich darauf geschupst und ist weggegangen. Ich sollte eine Stunde dort sitzen bleiben. Es war furchtbar. Rund um mich herum die Dunkelheit, schwarze Grabkreuze, die halb vom Schnee verdeckt waren und tiefe Stille. Ich hörte nichts und fürchtete mich sehr. Am Anfang weinte ich noch vor mich hin und zappelte auf dem Sack herum, aber allmählich wurde ich immer stiller und bewegte mich auch nicht mehr, ich habe einfach die Augen zugemacht, an Rosi gedacht und bin ganz starr geworden. So konnte mich keiner sehen und fortholen, einfach nur dasitzen und nicht mehr da sein. Damals habe ich zum ersten Male gespürt, dass niemand einem etwas tun kann, wenn man „fortgeht“, starr wird. Das habe ich noch oft im Leben gebraucht, immer, wenn es ganz furchtbar wurde, bin ich „fortgegangen“, auch damals in der Schule, als Klaas mich angelächelt hat, der ist bis zu mir durchgekommen, deshalb ist er auch mein Freund geworden. Wie lange Peter mich auf dem Friedhof hat sitzen lassen, weiß ich nicht, aber irgendwann ist er gekommen und war furchtbar erschrocken, weil ich mich nicht bewegt habe, als er mich geschüttelt hat. Immer fester hat er an mir rumgezupft, aber ich habe die Augen nicht aufgemacht und mich kein bisschen geregt. Und da hat er Angst bekommen. Er hat mich hoch gehoben, seine dicke Jacke um mich gepackt und nach Hause getragen. Im Flur sind wir dem Vater in die Arme gelaufen, der im Stall nach einer Kuh geschaut hatte. Nur wenige Worte haben genügt, dass der Vater verstanden hat. Peter wollte ausprobieren, ob das stimmte mit der Matthiasnacht auf dem Friedhof. Viel gesagt hat der Vater nicht, sondern einfach ausgeholt und dem Bruder eine Ohrfeige versetzt, die sich gewaschen hatte. Einundzwanzig Jahre war er damals alt, aber das hat er sich gefallen lassen müssen. Mich hat der Vater in sein Bett gebracht, die Mutter hat heißen Holundersaft und Milch mit Honig geholt, ein dickes Federbett haben sie über mich gedeckt und aufgepasst, ob ich wieder anfing zu sprechen. Lange hat es gedauert, bis ich die Augen aufgemacht und Arme und Beine bewegt habe, sie hatten schon gedacht, es sei vorbei mit mir. Selbst die Mutter, die sonst sehr zurückhaltend war und uns Kinder kaum jemals angefasst hat – es sei denn, um Ohrfeigen zu verteilen – hat mir immer wieder über die heiße Stirn gestrichen, mein Haar beiseite geschoben und meine kalten Hände mit ihren eigenen gewärmt. Am nächsten Morgen ist es mir schon viel besser gegangen, und außer einer Erkältung ist mir äußerlich wenig geschehen. Peter bin ich aus dem Weg gegangen, wo es nur ging, denn sonst setzte es oft eine Kopfnuss von ihm, weil „die Hex“ schuld daran war, dass der Vater ihm eine gehörige Standpauke gehalten hatte. Diese Geschichte habe ich auch Klaas nie erzählt, der mochte Peter sowieso nicht, weil der immer so gepoltert hat und überall den Wortführer spielte. Als der Bruder ihm gesagt hat, dass die Mutter vor meiner Geburt einen Fuchs gesehen hat und ich deshalb rote Haare habe, hat er nur den Kopf geschüttelt und ist weggegangen. Aber alle haben es immer wieder gesagt, und da habe ich geglaubt, dass es gestimmt hat. Woher hätte ich denn sonst meine roten Haare gehabt? Niemand in unserer Familie hatte rote Haare, niemand im ganzen Dorf hatte rote Haare, und ich hatte noch kein Kind mit einem Schopf wie meinem gesehen. Louise, die war blond, die hatte Zöpfe, so wollte ich sein, und die anderen waren braun oder ganz dunkel, aber keine rot. „De ruure Lene“ war ich, „de ruure Lene von de Häh“.
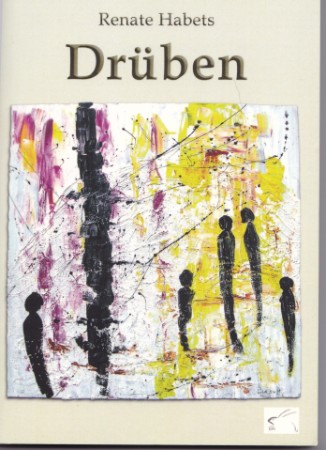
Im September 2015 in der Edition Paashaas Verlag erschienen. Nicht mehr verlegt, aber noch Restexemplare bei mir zu kaufen.
Erzählt wird die Geschichte eienr Berlinerin, die weder im Osten noch im Westen Deutschlands eine Heimat finden kann.
I. Zuhause
Hier war es. Jeden Sonntag hat er hier gestanden. Lange. Unbeweglich. Ganz nah an dem eisernen Deckel, der nahe an der Hauswand in den Boden eingelassen ist. Unauffällig. Achtlos geht man an ihm vorüber, nur er, er ist hier immer stehen geblieben, hat sich, als brauche er eine Stütze, an die Hauswand gelehnt und aufgeschaut zu dem Himmel über ihm. Dem Himmel, blau und klar, wolkenverhangen, voller Schnee oder Regen. Achtundzwanzig Jahre lang hat er so gestanden und gewartet, jeden Sonntag. Fast 1500 Sonntage müssen so zusammen gekommen sein. Sonntage, an denen er sich scheinbar entspannt an der Hauswand mit der abblätternden Farbe abgestützt hat, bis er das Rumpeln hörte, tief unter ihm. Dann hat er sich angespannt, innerlich. Äußerlich hat man ihm nichts ansehen können, das wäre zu gefährlich gewesen. Aber diesem Rumpeln in der Tiefe hat er gelauscht und genau verfolgt, wie der Zug dort unten langsam über die Schienen von Nord nach Süd durch das Dunkel gefahren ist, ohne anzuhalten. Der Luftzug, der im Vorüberfahren durch die Schlitze des eisernen Deckels zu ihm hoch wehte, war der Gruß, auf den er wartete. Der Gruß von ihr, seiner Tochter, der er nur so noch nahe sein konnte. Ausgekostet hat er ihn, bis nichts mehr vorhanden war, verweht in den Himmel dort oben, blau, wolkenverhangen, voller Schnee oder Regen. Eine Weile später ist der Gegenzug gekommen, von Süd nach Nord. Wieder ein Rumpeln und dann der ersehnte Luftzug, der zweite Gruß, der ihn mit ihr verband, jeden Sonntag.
Ja, hier ist es gewesen. Mit geschlossenen Augen saß sie an ihrem Tisch, und ihr war, als sehe sie ihn, diesen Deckel, und als spüre sie ihn nun, diesen Luftzug, den die vorüberfahrende Bahn erzeugte. Und sie sah die hagere Gestalt des Vaters, die an dieser Hauswand auf der Chausseestraße lehnte, schräg gegenüber dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Den eisernen Deckel gab es immer noch, und immer noch fuhren die U-Bahnen von Nord nach Süd und von Süd nach Nord unter ihm her. Und wenn man genau hinhörte, am besten am Sonntag, da war es stiller auf der Straße, vernahm man auch das Rumpeln von unten und spürte das Wehen. Aber heute hielten die Bahnen wieder am Naturkundemuseum und auch dem Oranienburger Tor, und der Putz an der Hauswand blätterte nicht mehr ab, sondern strahlte in hellem Beige, frisch gestrichen und einladend.
So genau konnte sie diese Stelle in sich erwecken. Der Vater hatte sie ihr gezeigt, als dies wieder möglich war. Sie meinte, den Schriftzug im äußeren Kreis vor sich zu sehen: Budde & Goehde Berlin S, und den fünfzackigen Stern mit dem Firmenzeichen in der Mitte, umgeben von zwei geschlossenen Kreisen und drei durchbrochenen. Wunderschön hatten sie gearbeitet, früher. Allerdings hatte sie in den achtundzwanzig Jahren, in denen sie nicht in der Stadt gelebt hatte, nichts von diesem Ort gewusst. Dass der Vater häufig von ihrer Wohnung quer durch die Stadt zu dem Friedhof ging, den er liebte, das hatte sie gewusst, denn schon als kleines Mädchen war sie an seiner Hand neben ihm her gehüpft, wenn sie zu einem ihrer Sonntagsspaziergänge aufbrachen, nur der Vater und sie, nie mit der Mutter. Diesen Weg kannte sie gut, und sie hatte sich auf dem Friedhof zwischen den alten schiefen Grabsteinen und den steinernen Familienbegräbnissen oft gegruselt, war aber auch fasziniert gewesen von den stillen Marmorgestalten, die dort wachten. Nie jedoch wäre sie auf den Gedanken gekommen, dass der Vater an einem der Luftschächte der U-Bahn stand, um ihr nahe zu sein, nein, das hätte sie sich bei diesem so beherrschten Mann nicht vorstellen können. An einem Tag, als sie, die zurückgekehrte Tochter, und er, der alt gewordene, langsam und gebückt gehende Mann, einen ihrer Kindheitswege spazierten – vom „Berg“ hinunter in die Mitte – hatte er ihr zögerlich davon erzählt. Nachdem sie die seit ihrer Kindheit vertrauten Grabsteine, zu denen so viele neue gekommen waren, besucht und sich eine Weile auf der Marmorumrandung einer hugenottischen Gruft ausgeruht hatten, begann er plötzlich über die Zeit zu sprechen, die der Mauerbau sie getrennt hatte. Die Augen immer noch geschlossen glaubte sie, die Wärme dieses sonnigen Frühlingstages zu spüren und die leicht zittrige Stimme ihres Vaters zu hören. Und da hatte sie verstanden, wie einsam er sich ohne sie gefühlt, wie sehr er sie vermisst und herbei gesehnt hatte, ohne dass er dies aussprechen musste. Aber dass er jeden Sonntag zu diesem „Deckel“, wie er ihn nannte, gewallfahrt war – ja, wie eine Wallfahrt musste das gewesen sein! -, das hatte ihr doch sehr zugesetzt. Sechsundachtzigjährig war da, zugegebenermaßen immer noch gut zu Fuß, wenn auch langsam geworden, aber dennoch ein alter Mann! Und er hatte diesen Weg, von dem er ihr an jenem Frühlingstag erzählt hatte, all die Jahre allsonntäglich gemacht, seit er so alt gewesen, wie sie es nun war, als sie dort so nebeneinander in der Frühlingssonne saßen. Ihr war der Stein damals plötzlich sehr hart vorgekommen, daran erinnerte sie sich noch.
Die alte Dame öffnete fast widerwillig die Augen, als wolle sie eigentlich nicht in die Welt zurückkehren, die außerhalb ihrer selbst existierte. Die Achtzig hatte sie nun auch überschritten, und alle die Gänge und Fahrten, die sie früher durch Berlin gemacht hatte, konnte sie heute fast nur mehr in ihrem Kopf machen. Wenn niemand sie begleitete, war sie unsicher und fühlte sich hilflos, beinahe blind, wie sie mittlerweile war. Aber sie waren ja in ihr, alle diese Wege, sie konnte sie sich vorstellen, wozu musste sie sie noch einmal machen? Wozu? Ein tröstlicher Gedanke, der ihr die Einschränkungen durch das Alter leichter machte und ihre Zeit, die sie nicht mehr mit Lesen und kaum noch mit Klavierspielen verbringen konnte, füllte.
Heute war ihr, warum, wusste sie nicht, wieder einmal diese Stelle auf der Chausseestraße sehr nahe, an der der Vater geglaubt hatte, ihr in dem Luftstrom der U-Bahn zu begegnen. Es sei ihm immer so gewesen, als fahre sie gerade in diesem Augenblick unter ihm her und halte für einen Moment seine Hand, hatte er ihr, leicht verschämt, gestanden und sie eindringlich angeschaut, ängstlich, ob sie dies auch verstehe oder gar über ihn lache. Nur zu gut hatte sie begriffen, was in ihm vorgegangen war, und den Kopf abgewendet, damit er die Tränen, die ihr in die Augen gestiegen waren, nicht sehen konnte. Erst dann hatte sie ihn anblicken, seine Hand nehmen und sagen können: „Ja, Vater, das verstehe ich.“ „Wölkchen“, hatte er sie bei ihrem Kindernamen gerufen und mit den Fingern leicht ihre Handinnenfläche liebkost, wie er es immer getan hatte, wenn sie als kleines Mädchen einen Kummer hatte.
Hatte er ihren Schmerz gespürt, den Schmerz um den einsam älter Werdenden, dem eine Illusion so wichtig war, dass er ihr jeden Sonntag widmete? Denn das war es ja, eine Illusion, wenn er glaubte, einen Hauch von ihr in dem plötzlichen Luftstoß von unten zu spüren. Zu dieser Zeit war sie bereits lange nicht mehr in Berlin, das wusste er, also konnte sie gar nicht in einer dieser Bahnen tief unten sitzen, die er dort oben vorbeifahren spürte. Und dennoch, er fühlte sich ihr dort nahe! Das hatte sie verstanden an jenem Tag auf dem Friedhof.
Einmal, ja einmal hätte es Realität sein können, dass sie unter ihm durch diesen langen gespenstischen Tunnel gefahren war. Nur ein einziges Mal hatte sie sich bei einem ihrer wenigen Besuche in Berlin getraut, mit der U-Bahn von Süd nach Nord zu fahren und zurück. Mit Wera, ihrer Freundin aus Wilmersdorf, war sie mit der heutigen U6 zum Wedding gefahren. Und da hatte sie erlebt, wie beklemmend es war, wenn man die Geisterstrecke unter Ostberlin durchquerte. „Letzte Station in West-Berlin!“ hatte sie die warnende Lautsprecherstimme in der Kochstraße gehört. Schlagartig hatte sich die Stimmung in dem Waggon verändert. Ruhig war es geworden, gedämpft, es herrschte gedrücktes Schweigen, während man durch die finsteren Tunnel und abgedunkelten Geisterbahnhöfe fuhr, in denen man nur schemenhaft bewaffnete uniformierte Schattengestalten sehen konnte, die ihr wie Geister erschienen. Kaum atmen hatte sie können vor irrationaler Angst, hier festgenommen zu werden, hier unten in diesen feindlichen, düsteren Gängen, wo keiner sie je mehr wiederfinden würde. Man sah nur die vorbeihuschenden Lichtreflexe aus den einzelnen Waggons, die ein schwaches Muster an die dunklen Wände warfen, und sie hatte aufgeatmet, als sie am Leopold Platz die U-Bahn verlassen hatten. Die Rückfahrt hatte sie nur unter Aufbietung aller inneren Kräfte überhaupt antreten können.
Ja, bei dieser einzigen Fahrt hätte es sein können, dass der Vater und sie für eine Sekunde in dem Luftzug Verbindung aufnahmen. Ein Sonntag war es ja wohl gewesen, an dem sie diese Fahrt zu Weras Tante unternommen hatten, und die Tageszeit hätte auch stimmen können. Vielleicht, ja vielleicht hatten Vater und Tochter an jenem Tag einen wirklichen Hauch Kontakt gehabt.
Oft hatte sie sich später gefragt, nachdem der Vater ihr von jenen Augenblicken „an dem Deckel“ erzählt hatte, ob das für ihn nicht gefährlich gewesen sei. Sie wusste ja nur allzu genau, wie man beobachtet und bespitzelt wurde – das hatte sie nahezu ihr ganzes Leben bis zu ihrer „Flucht“ erlebt -, und ein alter Mann, der jeden Sonntag zur etwa gleichen Zeit an der immer gleichen Hauswand lehnte, war der nicht verdächtig? Aber vielleicht war es ja gerade diese automatenhafte Gleichartigkeit gewesen, die sein Handeln unbedenklich erscheinen ließ? Vielleicht war er ja auch vorgeladen worden... .
Er jedenfalls habe sich nie gefürchtet, hatte er auf ihr eindringliches Fragen hin gesagt, er habe das einfach tun müssen. So sei es gewesen und nicht anders. Nie hatte sie mehr über seine Beweggründe erfahren. Sie kannte ihren wortkargen Vater, der nur so viel von sich preisgab, wie er wollte. Später allerdings war ihr eine Erklärung eingefallen, mit der sie sich zufrieden gab. An jenem ominösen 12. August 1961 wollte sie mit Vera, ihrer Schulfreundin, ein Konzert in Westberlin besuchen – das konnte man ja damals noch – und anschließend irgendwo mit dieser sitzen und die Gemeinsamkeit genießen. Da es spät werden konnte, hatte ihr die Freundin vorgeschlagen, doch am Remscheider Platz bei ihr zu übernachten. Und so brach sie an diesem schönen warmen Sommertag voller Vorfreude auf, begleitet von ihrem Vater, der es sich nicht nehmen lassen wollte, ihr die Tasche bis zur U-Bahn zu tragen. Neben dem Vater, der ihre Tasche schwenkte und ihr für den Sonntagabend ein gemeinsames Bier im „Schultheiß“ versprach, lief sie zur Schönhauser Allee, wo die U-Bahn oberirdisch auf Stelzen fuhr. Natürlich stieg er mit ihr die Treppen zum Bahnsteig hinauf, reichte ihr dann die Tasche in die abfahrbereite Bahn und küsste, als diese losfuhr, den Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand und pustete seiner lachenden Tochter diesen Kuss zu. Das war das Letzte, was sie achtundzwanzig Jahre lang voneinander gesehen hatten: ein gepusteter Kuss auf dem Bahnsteig, ein Lachen durch das Fenster. Denn sie trat nach diesem 12. August die Rückfahrt zum Prenzlauer Berg nicht mehr an. Beide hatten sich also an jenem Tag zum letzten Mal an der U-Bahn gesehen. Zog es ihn deshalb dorthin in die Chausseestraße, wo West und Ost einander unterirdisch berührten, wenn auch nur scheinbar?
Von Edgar wusste sie – er hatte es ihr irgendwann zu Beginn des neuen Jahrtausends erzählt -, wie stark bewacht dieses kleine Stückchen West, die durchfahrenden U-Bahn Waggons, dort unten waren. Edgar, der Gefährte ihrer Kinder-und Jugendzeit, Grenzpolizist?
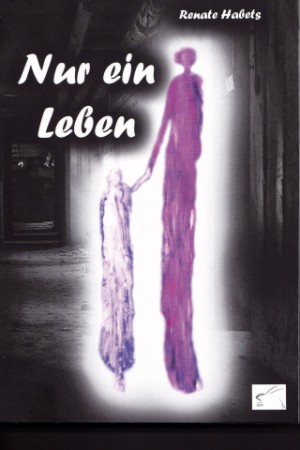
Im September 2019 in der Edition Paashaas Familie erschienen. Erzählt die Geschichte von Judith, der es nur sehr schwer gelingt, einen eigenständigen Weg zu finden.
Leseprobe:
Kriegsende
Platsch. Gebannt schaute Judith dem Tropfen hinterher, der sich oben an der Decke gebildet hatte. In dem flackernden Licht der Birne, die an ihrem Kabel leicht schaukelte, konnte sie ihn erkennen. Platsch, ein zweiter folgte. An den steinernen Wänden, die aus den hier in der Gegend gebrochenen Quadern bestanden, bildeten sich Wassertropfen. Wie gebannt schaute das Mädchen dorthin. Das lenkte ab. Man musste dann nicht mehr an die zwanzig Personen denken, die mit ihr zusammengepfercht in diesem Kuhstall saßen, seit gestern schon. Eine lange Zeit, sehr lang, wenn man nichts anderes zu tun wusste, als die Wassertropfen zu beobachten. Aber immer noch besser, als vor sich hinzustarren und die Angst zuzulassen, die in einem schwelte.
Alle hier in diesem Raum hatten Angst, das wusste sie. Das konnte sie spüren. Nur der jüngste von ihren fünf Brüdern, Vincent, hatte sich auf dem Schoß ihrer Mutter zusammengerollt und schlief. Mitunter zuckte er im Traum oder sein kleiner Mund öffnete sich leicht, als wolle er etwas sagen. Dann schlief er wieder ruhig weiter. Ihre beiden älteren Brüder, Aron und Lucas, saßen im tiefen Dämmerlicht in der hinteren Ecke des Raumes und hatten ein Blatt Papier mit einer Mühlezeichnung zwischen sich liegen, auf dem sie verschieden gefärbte Steine hin und her schoben. Aber immer wieder schaute einer der beiden auf, blickte zur Mutter und dem kleinen Bruder, und dann verschob er erneut eine der kleinen provisorischen Spielfiguren. In Krieg und Keller schienen sie sich eingerichtet zu haben, eingerichtet in dem Haus, in dem sie nicht besonders willkommen, aber auf das sie in diesen Wirren angewiesen waren. Die Bäuerin, bei der sie untergekommen waren, hockte mit ihren vier minderjährigen Kindern auf den Strohballen neben der Stalltüre. Ihr Jüngster, der achtjährige Karl, hatte sich ganz klein gemacht, damit Judiths Bruder Stephan noch neben ihn passte. Mit ihm, dem Neunjährigen, hatte er sich angefreundet, und sie waren, wo immer es ging, zusammen. Der Großvater und seine Frau saßen ebenfalls hier unten, drehten die Rosenkränze in ihren Händen und murmelten vor sich hin: „Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Gegrüßet seist du, Maria …“
Zwischen ihren beiden unverheirateten Töchtern, den Schwestern der Bäuerin, lehnte sich Gabriel, der Fünfjährige, vertrauensvoll an eine von ihnen, den Daumen im Mund. Außerdem konnte Judith in dem flackernden Licht noch den kriegsuntauglichen Bruder der beiden und die Nachbarn, eine Mutter mit ihren drei Kindern, erkennen.
Einundzwanzig Personen in diesem Raum neben dem Keller, der in Friedenszeiten drei Kühen zum Aufenthalt diente, das war schon arg. Aber hier war man einigermaßen sicher und geschützt, erreichte man ihn doch von der Hauptstraße aus nur über eine enge knarrende Kellertreppe aus Holz mit schiefgetretenen Stufen. Das Gute war, dass er nach hinten raus eine Tür hatte und zu der Hardt hin ebenerdig war, so dass man aus ihm dorthin hätte fliehen können, wenn es notwendig war.
An Fliehen jedoch dachte zu dieser Zeit niemand. 1945 war der Westerwald, in dem sie sich befanden, hart umkämpft. Bisher hatten er und das Siegerland den Krieg nur in Form von Luftangriffen gekannt. Im Frühjahr war er für Köln und viele Großstädte bereits nahezu vorbei, aber im Westerwald kam es zu dramatischen Ereignissen. Hier begann er für die meisten erst zu diesem Zeitpunkt richtig. Viele Soldaten, davon hatte man in den Dörfern gehört, waren in den aussichtslosen Kampf um die Remagener Brücke geschmissen worden. Über 8000 Bewaffnete und riesige Mengen Kriegsmaterial waren von den Amerikanern über den Rhein geschafft worden. Über die Sieg rückten sie unaufhaltsam vor, auch auf dieses kleine Dorf Blickhauserhöhe, in dem man im Kuhstall voller Angst wartete, was geschehen würde. Dass man den Krieg gewinnen könnte, daran glaubte niemand mehr. So waren alle Gespräche verstummt und die Gesichter der Erwachsenen besorgt. Alle kauerten hier tag- und nachtlang in diesem engen Stall, so gut es eben möglich war.
Dabei konnten sie noch dankbar sein, dass sie überhaupt hier sein konnten und einigermaßen beschützt waren. Zumindest waren sie dem Freien und der Kälte entkommen, für eine Weile auf jeden Fall. Sieben Personen, eine Mutter und ihre sechs Kinder. Der dreizehnjährigen Judith war durchaus klar, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, sie, die Mutter und die fünf Brüder.
Wochenlang waren sie über Land gezogen. Judith kam es wie ein ganzes Leben vor. Nachdem die Züge, mit denen sie von Potsdam aus gen Westen gefahren waren, nicht mehr fuhren, hatte die Mutter das Allernotwendigste auf einen winzigen Leiterwagen gepackt, so dass der kleine Vincent gerade auch noch auf ihm sitzen konnte, wenn seine Beinchen ihn nicht mehr weiter trugen. Er war ja erst drei, und die langen Strecken, die sie zurücklegten, konnte er noch nicht laufen. Den anderen Kindern hatte die Mutter das an Tragbarem gegeben, was sie nur irgendwie transportieren konnten. Außer Gabriel, denn auch er war mit seinen fünf Jahren vollauf mit dem Weiterkommen beschäftigt. Dazu trug jedes von ihnen zwei Garnituren der Kleidung, die sie mitgenommen hatten. Alles, was keine und keiner der Wetters – so hieß die Familie – mitnehmen konnte, wurde von der Mutter kurz entschlossen zurückgelassen. Das Leben war wichtiger als irgendwelche Habseligkeiten, mochten sie auch noch so wertvoll sein.
Von kurz hinter Köln an war die Mutter mit den fünf Söhnen und der Tochter Richtung Westerwald gezogen. Dort sollte es noch sicher sein. Den Leiterwagen zog sie hinter sich her, oft den Kleinsten schlafend zwischen den Gerätschaften, die sie auf ihm verstaut hatte. Die übrigen fünf Kinder gingen mal vor, mal hinter ihr, langsam oder schneller, so wie ihre Kräfte es zuließen. Es war ein sehr beschwerlicher Weg, meist bei Regen, der zu Beginn des Jahres 1945 anhaltend niederging und die Wege aufweichte und schwer begehbar machte. Man sah oftmals eines der größeren Kinder, wie sie die Mutter an der Deichsel beim Ziehen unterstützten oder den Wagen von hinten drückten. Der neunjährige Stephan reichte immer wieder seinem kleinen Bruder Gabriel die Hand, damit der Hindernisse besser überwinden oder die Pfützen umgehen konnte. Sie schliefen unterwegs am Wegrand in überdachten Schuppen oder Scheunen, ganz, wie sich ein Schlafplatz finden ließ. Gemütlich und einladend war er nie, aber die Mutter drängte auf Weiterkommen. Sie wollte ihre Kinder in Sicherheit wissen, behaust und nicht ununterbrochen flüchtend auf der Straße. Das glaubte sie auch, ihrem Mann schuldig zu sein, Franz Wetter, der in irgendeinem Lager – sie wusste nicht, wo – als Pfarrer, der nicht schweigen wollte, interniert war. Sie glaubte, es sei besser, Potsdam zu verlassen, als den Russen dort in die Hände zu fallen. Das hatte sie getan und dabei nicht gedacht, dass sie hier, in dem vermeintlich ruhigen Westerwald, nicht sicher vor den Amerikanern sein würde.
Mit ihren Kindern, immer den Leiterwagen hinter sich, irrte sie von einem der Dörfer ins nächste. Irgendwer musste ihnen doch Obdach geben. Es konnte doch nicht sein, dass man sie immer weg- und weiterschickte. Judith hatte beobachtet, dass die Mutter vornehmlich dort anklopfte, wo sie eine mitleidige Seele erhoffte, die ihnen Unterkunft bot. Aber sie wurden nur wieder davon geschickt, oft sogar gejagt. „Schert euch fort! Wir haben selbst nichts!“ Gerade einmal für eine Nacht ließen die Leute sie auf dem Hof, wenn sie Glück hatten. Aber meistens durften sie nicht einmal das.
Hochmütig sahen gerade die Frauen aus, die wie die Mutter als Pfarrersfrau gearbeitet und ihre Männer begleitet hatten. Frauen wie sie selbst, von denen sie am ehesten Verständnis erwartet hatte. Aber diese hatten sich hoch aufgerichtet an die Hoftür gestellt. Nicht einmal den gestampften Lehmboden des abgeschlossenen Platzes hinter dem Zaun hatten sie betreten dürfen, so als hätte die Erlaubnis ihnen ein Bleiberecht gewährt. Schon an dem Eingangstor war ihnen der Zugang verboten worden. Der hoch ausgestreckte Zeigefinger, der in die Weite der Felder, Wiesen und Wälder wies, zeigte ihnen, dass hier nicht ihre Bleibe sein würde. Man schickte sie fort, überall. Eine Mutter und ihre sechs Kinder! Zwischen sechzehn und drei Jahren! Frauen, wie die Mutter eine gewesen war, stellten sich hochmütig an das Tor und wiesen sie schroff ab, ohne Brot, ohne Wasser. Von oben herab blickten sie auf ihre kleine Schar herab, kopfschüttelnd. Sie, die Mutter, die einstmals über mehr als ausreichend Hab und Gut verfügt hatte, musste sich wie eine Bettlerin vorkommen. Aber da waren doch die hungrigen und müden Kinder …
Also zogen sie weiter und versuchten es ein neues Mal. Nur nicht an die Beschämung denken, den Stolz überwinden und erneut bitten. Zumindest schien es Judith so, die sich gut hineinversetzen konnte, was die Mutter für die Kinder auf sich nahm.
Mindestens zwei Wochen waren sie so durch das zunächst noch flache Siegerland Richtung Hügel gezogen, immer verkommener wirkend, immer hoffnungsloser. Da sollte auf einmal eines Tages ihre Qual ein Ende finden. Gegen Abend war es schon. Eine Stunde von Wissen entfern war die kleine Gruppe über den Hügel, Stuhl genannt, auf die Betzdorfer Landstraße gekommen. Hinter der Gaststätte, die gegenüber der Kirche lag, stand ein Fachwerkhaus, das geradezu auf das Jugendheim schaute. Zwei Frauen verließen es gerade und blickten die Frau an, die mit ihren Kindern am Gartenzaun verschnaufte.
„Wo kommt ihr her?“
„Potsdam.“
„Poootsdaaam? Wo wollt ihr denn hin?“
„Irgendwohin. Trocken soll es sein und weg vom Krieg.“
„Das wollten wir auch. Wir sind mit unseren Kindern aus Köln gekommen und wohnen im Jugendheim. Wir haben die Bomben nicht mehr ausgehalten.“
„Die Bomben …“, murmelte
Leseprobe













